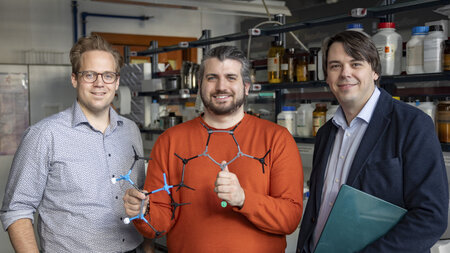Als der europäische Geist antrat
Beate Neuss, Professorin für Internationale Politik an der TU Chemnitz, reflektiert 60 Jahre Europäische Union
Vor 60 Jahren wurde der Grundstein für die Europäische Union gelegt. Warum? Weil man die elenden Kriege der Vergangenheit nicht fortführen wollte. Auch damals gab es Gegner eines vereinten Europas. Und doch: 1958 trat die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft in Kraft. Das Zauberwort hieß Kompromiss. Der Erfolg ließ aufhorchen.
Am Neujahrstag vor 60 Jahren startete ein Projekt, das nach dem Willen seiner Gründerväter - "Mütter" waren auf oberer Ebene nicht dabei - einen tiefen Bruch mit der europäischen Geschichte bewirken sollte: die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG); zugleich nahm die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) zur friedlichen Nutzung der Atomenergie die Arbeit auf. Das Datum der Vertragsunterzeichnung am 25. März 1957 beziehungsweise ihr Inkrafttreten am 1. Januar 1958 gilt als Gründungsdatum der Europäischen Union. Sechs Staaten - drei große: Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland, Italien, und drei kleine: Belgien, die Niederlande, Luxemburg - hatten sich bereit erklärt, einen großen europäischen Markt zu schaffen und Teile ihrer Souveränität auf Institutionen in Brüssel zu übertragen. Dabei wird leicht vergessen, dass die selben sechs Staaten auf der Grundlage eines Vorschlags des französischen Außenministers Robert Schuman bereits 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gegründet hatten. Mit ihr schufen die sechs Regierungen für die damals entscheidenden Kriegsindustrien gemeinsame Entscheidungsgremien, was nur sechs Jahre nach dem Krieg zwischen den früheren Feinden erstes Vertrauen wachsen ließ und zur Erprobung der gemeinschaftlichen Arbeitsweise führte. Nur auf dieser Basis war die EWG überhaupt denkbar.
Mit der Gründung dieser Organisationen war die Erwartung verbunden, dass das innovative, ja geradezu revolutionäre Konzept der Verflechtung der nationalen Volkswirtschaften und des Transfers von Teilen staatlicher Souveränität auf gemeinschaftliche Organe das grundlegende Übel beseitigen würde, das in Europa seit Jahrhunderten immer wieder zu Elend geführt hatte: Krieg. Seit dem Mittelalter ist kaum ein Jahrzehnt zu finden, in dem nicht die Gebiete der heutigen Europäischen Union in Kriege verwickelt waren. Kriege um die Vorherrschaft in Europa waren die blutigsten.
Letztlich waren es drei Interessen, die den Prozess seit 1950 vorangetrieben hatten: Nach den kontraproduktiven Auswirkungen des Versailler Friedensvertrags von 1919 war klar, eine derartige Knebelung der Bundesrepublik Deutschland konnte den Frieden nicht erhalten. Ihr Wiederaufstieg sollte jedoch eingehegt erfolgen - nach drei von Deutschland seit 1870 begonnenen Kriegen war dies auch ein Anliegen deutscher Politiker. Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler, hatte als überzeugter Europäer schon in der Zwischenkriegszeit für eine enge Kooperation mit Frankreich geworben. Der Kalte Krieg beschleunigte die Einbindung der Bundesrepublik als wirtschaftlich wichtigen, bevölkerungsreichen Staat an der Grenze der Systemblöcke. Ferner ging es nicht nur um Sicherheit vor Deutschland, sondern um Sicherheit mit Westdeutschland: Mit der durch die Integration beförderten wirtschaftlichen Prosperität in den Mitgliedsstaaten konnte sich die Demokratie stabilisieren; politisch konnten die Regierungen eng zusammenarbeiten. Beides trug zur Sicherheit des Westens vor dem weiteren Ausgreifen des sowjetischen Einflusses über die Mitte Europas hinaus bei. Und letztlich sollte die Wirtschaftsgemeinschaft dazu beitragen, Wohlstand wiederzugewinnen und den enormen Machtverlust zu mindern, den Europa erlitten hatte. Vor 1945 war Europa das Machtzentrum der Welt gewesen. Nun war es unter dem bestimmenden Einfluss der USA und der Sowjetunion. Es ging nicht zuletzt um die Selbstbehauptung und Handlungsfähigkeit Europas.
Die Verhandlungen über die Verträge für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaftwaren schwierig. Alle Mitgliedsstaaten hatten Interessen, die bedient werden mussten, damit die Parlamente die Vorteile für ihr Land erkennen konnten. Zentral war jedoch - wie bis heute - der Interessensausgleich zwischen Frankreich und Deutschland.
Auch wenn uns die heutigen Divergenzen in der EU als sehr groß erscheinen, so waren doch Mitte der 1950er-Jahre die Kontroversen um einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit gemeinsamer Agrarpolitik und einer nuklearen Energiepolitik vergleichbar groß. Westdeutschland, das Wirtschaftswunderland mit Vollbeschäftigung, eroberte mit seinen Produkten die Weltmärkte; diesem Wettbewerb fühlte sich das protektionistische Frankreich nicht gewachsen. Deutschland wiederum fürchtete um die Zukunft seiner Bauern wegen der besseren Böden und des besseren Klimas in Frankreich und Italien. Zudem trieb Bonn die Sorge um, ein Kompromiss mit seinen weniger wettbewerbsfähigen Partnern könnte zu hohen Außenzöllen der EWG führen. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard war wegen der Sorge um Export und Wettbewerbsfähigkeit ein Gegner einer EWG. Frankreich wollte die Entwicklung einer Nuklearenergie-Gemeinschaft. Die Reduzierung der Ölimporte sollte Devisen sparen und technologischen Entwicklungen Schub geben. Franz Josef Strauß, Bundesminister für Atomfragen, hätte lieber mit den weiter entwickelten USA und Großbritannien kooperiert und lehnte Euratom ab. Bundeskanzler Adenauer nutzte seine verfassungsmäßige Richtlinienkompetenz, um Erhard und Strauß zu konstruktiven Verhandlungen zu zwingen. Er sah den politischen Wert eines sich vereinigenden Europas als zentral für die Zukunft Deutschlands und des Kontinents an.
Die Verhandlungen standen mehrfach auf der Kippe. In der entscheidenden Phase mussten die Europäer erfahren, wie verletzlich sie waren: Im Herbst 1956 führte die Suez-Krise zu der Erkenntnis, dass die Interessen der USA und der europäischen Mächte nicht identisch waren. Als Großbritannien und Frankreich zusammen mit Israel den vom ägyptischen Staatspräsidenten Nasser verstaatlichen Suez-Kanal zurückerobern wollten, drohte Moskau mit einem Angriff auf die Europäer - auch mit Atomwaffen. Washington stellte sich nicht hinter London und Paris, sondern zwang die Staaten zum Rückzug.
Die stete Sorge nicht nur der Bundesrepublik, die USA könnten zu einem Interessensausgleich mit der Sowjetunion zu Lasten der Europäer kommen, schien berechtigt. Zeitgleich schlug Moskau im Schatten der Suez-Krise die ungarische Reformbewegung blutig nieder. Die in diesen Krisen überaus sichtbare Machtlosigkeit und Demütigung beförderte die Kompromissfähigkeit der Sechs, zumal als Folge des Suez-Konfliktes der Großteil des von den Europäern benötigten Öls ausblieb. Die damals als zukunftsweisend betrachtete Kernenergie konnte unabhängiger vom Nahen Osten machen. Als Bundeskanzler Adenauer auf dem dramatischen Höhepunkt der sowjetischen Drohung seine Reise nach Paris zu bilateralen Verhandlungen über die Verträge nicht abbrach, wurde dies von der französischen Regierung und dem Parlament als Zeichen von Solidarität in Momenten der Schwäche verstanden. Diese Geste erwies sich als außerordentlich wichtig. Sie beförderte die Bereitschaft, schließlich beide Verträge anzunehmen.
So kamen die schwierigen Kompromisse zustande: Frankreich akzeptierte den gemeinsamen Industriegütermarkt, Deutschland den Agrarmarkt. EWG und Euratom würden nur gemeinsam ins Leben treten. Und: Deutschland akzeptierte die Einbeziehung der überseeischen französischen Gebiete in den gemeinsamen Markt, Frankreich die Fortsetzung des innerdeutschen Handels. Von den Regelungen des innerdeutschen Handels im Rahmen der EWG und dann der Europäischen Gemeinschaft profitierte die DDR in den nächsten Jahrzehnten erheblich. Die Partner sprachen zuweilen kritisch vom "zusätzlichen Mitgliedstaat". Sie stellten die Regelung bei den Verhandlungen für die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes 1986 erneut in Frage. Jedoch vergeblich, Bonn hielt an diesem wichtigen Band zwischen den beiden deutschen Teilstaaten fest. Die Ratifikation in den Parlamenten erfolgte nach heutigen Maßstäben europäischer Vertragsrevisionen im Rekordtempo und mit jeweils großen Mehrheiten. Erstmalig stimmte 1957 auch die SPD europäischen Verträgen zu.
Euratom entwickelte keine große Bedeutung: Das Öl floss bald wieder reichlich und billig und die Sicherheit von Kernreaktoren war problematisch. Lediglich zur Überprüfung der Sicherheit von Reaktoren und nuklearen Stoffen behielt die Organisation ihre Bedeutung. Die EWG hingegen entwickelte sich über Erwarten erfolgreich. Der Abbau der Zölle untereinander, der niedrige gemeinsame Außenzoll und die Verflechtung der Märkte führten zu einer Intensivierung des Handels und des Wohlstands; der Handel wuchs im ersten Jahrzehnt zwischen den sechs Partnerstaaten mit über 220 Prozent rasant, aber auch der Welthandel der Mitglieder nahm enorm Fahrt auf. Walter Hallstein wurde der erste, einzige deutsche, Präsident der EWG-Kommission. Diese Funktion in Euratom ging an den Franzosen Armand. 1967 wurden die bis dahin separaten Institutionen der EWG, Euratom und Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl als Europäische Gemeinschaften (EG) zusammengeschlossen.
Seit 1950 war der wirtschaftliche Zusammenschluss vor allem als Instrument gesehen worden, das längerfristig zu einem politisch vereinten Europa führen sollte. Erweiterung und Vertiefung waren von Anfang an das Ziel; das Endziel wurde jedoch bis heute nie präzise definiert. So hieß es in der Präambel des EWG-Vertrages, die Mitglieder hätten sich zusammengeschlossen "in dem festen Willen, die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen". Dies steht in allen seither folgenden Verträgen, die die Integration weiterentwickelten. Mit dem Maastrichter Vertrag zur Gründung einer Europäischen Union wurde 1992 ein weiterer großer Schritt hin zur Integration gemacht. Er brachte auch den Euro und Kompetenzen in der Außenpolitik.
Anfangs sprachen europäische Politiker von den "Vereinigten Staaten von Europa", die es zu schaffen gelte. Kein Politiker - auch nicht der überzeugte Europäer Adenauer - hatte dabei die Vorstellung, Deutschland, Belgien oder Italien würden ihre Identität in einem europäischen Bundesstaat verlieren. Der Begriff drückte eher den Wunsch aus, durch das Zusammenfassen von staatlicher Souveränität auf europäischer Ebene gemeinsam das Potenzial zu erreichen, das Europa wieder Handlungsfähigkeit zur unabhängigen Gestaltung seiner Zukunft geben würde. Aus diesem Grund hat wohl auch SPD-VorsitzenderMartin Schulz den Begriff vor kurzem wiederbelebt.
Krisen in diesem historisch revolutionären Prozess der Neugestaltung der europäischen Strukturen - bei Betrachtung der europäischen Geschichte ein ungemein ambitioniertes Projekt - blieben und bleiben nicht aus. Alles andere wäre erstaunlich. Krisen begleiten die EWG/EG/EU trotz der Erfolge seither. Immer ging es um die Frage der Kompetenzverteilung zwischen dem europäischen Staatenverbund und den Nationalstaaten - so auch heute. Sie ist aber unter den inzwischen 28 Staaten sehr viel schwerer zu lösen, zumal vor allem die neuen mittelosteuropäischen Mitglieder durch eine andere Geschichte geprägt sind. Aufgrund des Verlustes von Souveränität unter vier Jahrzehnten sowjetischer Herrschaft legen sie besonderen Wert auf staatliche Souveränität. So auch die ehemalige Weltmacht Großbritannien, die aufgrund des Beharrens auf Souveränität erst 1973 beitrat und nun wieder austritt. Wie schwer dies ist, zeigt, dass die Staaten - wie von den Gründern gewünscht - in sehr vielen Bereichen engstens miteinander verwachsen sind. Ob im 21. Jahrhundert jedoch Souveränität im ursprünglichen Sinn außerhalb des europäischen Staatenverbunds überhaupt erreichbar ist, ist mehr als fraglich: Die wirtschaftlichen, technologischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen in einer globalisierten Welt machen an Grenzen nicht Halt. Gestaltungsfähigkeit für ihre Zukunft in der neuen internationalen Mächtekonstellation gewinnen die europäischen Nationalstaaten nur in engem Verbund. Die Schwächung der EU ist deshalb das explizite Ziel Moskaus.
70 Jahre Frieden: Auch dies sollte man nicht für dauerhaft gegeben ansehen. Feindselige populistische Äußerungen gegen EU-Partner sind Mode geworden. In den Reformen, vor denen die Europäische Union derzeit steht, ist viel zu gewinnen - oder sehr viel zu verlieren.
Zur Person: Prof. Dr. Beate Neuss
Beate Neuss wurde 1953 in Essen geboren. Von 1971 bis 1978 studierte sie an der Universität Münster und der Ludwig-Maximilians-Universität München Politikwissenschaft, Mittlere und Neuere Geschichte und Soziologie. 1983 wurde sie im Fach Politikwissenschaft promoviert, 1992 erfolgte die Habilitation auf diesem Gebiet. Neuss arbeitete von 1980 bis 1993 als wissenschaftliche Assistentin bzw. Oberassistentin am Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität München. Von 1978 bis 1994 nahm sie einen Lehrauftrag an der Außenstelle München der Wayne State University wahr. 1985 hatte Neuss eine Gastprofessur an der University of Minnesota, Minneapolis (USA). In den kommenden drei Jahren führte sie mehre Forschungsprojekte in die Vereinigten Staaten von Amerika. Von 1989 bis 1990 hatte sie einen Lehrauftrag an der Universität Bamberg und von 1992 bis 1994 war sie Lehrbeauftragte an der Hochschule für Politik, einer institutionell selbständigen Einrichtung an der Universität München. Seit 1994 ist Beate Neuss Professorin für Internationale Politik an der TU Chemnitz.
Von 1997 bis 2000 hatte Neuss das Amt der Studiendekanin der Philosophischen Fakultät inne und seit 1997 ist sie Vertrauensdozentin der Konrad-Adenauer-Stiftung an der TU Chemnitz. Seit 2014 ist sie Mitglied im Kuratorium der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung „Internationale Sicherheit“ der Universität Bonn. Neuss arbeitet in weiteren Gremien mit, zum Beispiel ist sie Mitglied der German Studies Association, USA. Zudem ist sie seit 2017 stellvertretenden Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft.
Weitere Informationen zum Thema Europa erteilt Prof. Dr. Beate Neuss, Telefon 0371 531-35012, E-Mail beate.neuss@phil.tu-chemnitz.de
Hinweis: Dieser Gastbeitrag von Prof. Dr. Beate Neuss erschien am 12. Januar 2018 in der Freien Presse , die der Veröffentlichung auf "Uni aktuell" zugestimmt hat. Angehörige der TU Chemnitz, die sich auch gern einmal in der Freien Presse fundiert äußern möchten, sind dazu eingeladen. Kontakt: chefredaktion@freiepresse.de und/oder mario.steinebach@verwaltung.tu-chemnitz.de.
Mario Steinebach
12.01.2018