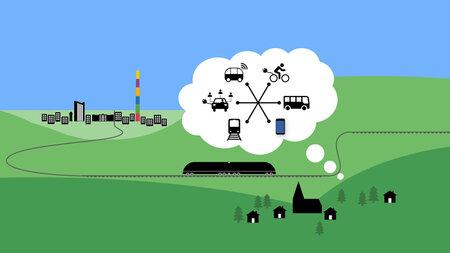Erzwungene Einsprachigkeit wäre autokratisch
Prof. Dr. Winfried Thielmann, Professor für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an der TU Chemnitz, meint, dass in der Wissenschaft Mehrsprachigkeit gepflegt werden soll und keine Monokultur
-

Prof. Dr. Winfried Thielmann, Professor für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache an der Technischen Universität Chemnitz und Wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Fremdsprachen. Foto: Screenshot "TUCtalk 6"
Eine konsequente Anglophonisierung der europäischen Wissenschaft wäre von großem Nutzen. Sie nützt den großen Wissenschaftsverlagen, die so ihre Umsätze steigern, ebenso wie den Wissenschaftsorganisationen und Universitäten, indem wissenschaftliche Leistungen durch scheinbar objektive Verfahren wie Zitationsindices vergleichbar und ökonomisierbar werden, und sie nützt den Wissenschaftlern, die sich in einem solchen System gut positioniert haben. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang praktisch nie gestellt wird, ist: Nützt die Anglophonisierung der europäischen Wissenschaft selbst? Wenn es das Kerngeschäft der Wissenschaft ist, neue Erkenntnisse und Ideen hervorzubringen - wird dieses Kerngeschäft durch die Anglophonisierung begünstigt oder wenigstens nicht beschädigt?
Anglophonisierung der europäischen Wissenschaft bedeutet nichts anderes, als eine mehrsprachige Wissenschaftslandschaft in eine einsprachige zu überführen. Es ist interessant, dass die Befürworter der Anglophonisierung in wissenschaftlicher Einsprachigkeit einen Fortschritt erblicken. Das ist völlig geschichtsvergessen. Es gab nämlich in Europa schon einmal eine Situation, in der sich die Wissenschaft einer einzigen „internationalen“ Sprache bediente, die zudem niemandes Muttersprache war: die Epoche der Scholastik, die das Lateinische als Wissenschaftssprache nutzte. Damals richtete man den Blick auf kanonische Texte wie die aristotelische Physik und förderte das in ihnen implizit enthaltene Wissen durch argumentationslogische Beweisführungen zutage. Als dann die frühneuzeitlichen Naturwissenschaftler wie Galilei und Newton nicht mehr in den Aristoteles, sondern in die Wirklichkeit selbst hineinsahen, mussten sie sich einer neuen sprachlichen Herausforderung stellen: Wenn zwei in die Wirklichkeit hineinsehen, sehen sie nicht dasselbe. Um diesen Dissens bearbeiten zu können, braucht es sprachliche Mittel, mit denen Intersubjektivität hergestellt werden kann. Das Lateinische der Scholastik hielt für solche Zwecke jedoch keine Ressourcen bereit. Es war vor allem für den argumentationslogischen Umgang mit kanonischen Texten gemacht.
Daher gaben die neuzeitlichen Naturwissenschaftler das Lateinische auf und bauten ihre jeweiligen Muttersprachen zu Wissenschaftssprachen aus. Denn zur Herstellung von Intersubjektivität bedurfte es sprachlicher Ressourcen, wie sie nur in großen, gesamtgesellschaftlich vorgehaltenen Sprachen anzutreffen sind. Vor diesem Hintergrund scheint es absurd, einen solchen europäischen Vorteil im globalen Wettbewerb zugunsten neuer scholastischer Einsprachigkeit zu opfern, nur weil Akteure, die teils weder von Wissenschaft noch von ihrer Sprachlichkeit etwas verstehen und mitunter nicht einmal ansatzweise Englisch können, sich noch vor die amerikanische Lokomotive spannen wollen.
Man unterstellt, dass andere Sprachen einfach „andere Wörter“ für dieselben Dinge haben. Wie ich im Folgenden am Englischen und Deutschen zunächst an einem Beispiel aus der Alltagswelt und anschließend an einem wissenschaftlichen Beispiel zu zeigen versuche, ist dies keineswegs der Fall - was massive Auswirkungen darauf hat, wie eine Sprache als Wissenschaftssprache funktioniert. Die Ruder, mit denen man ein Flugzeug steuert, heißen auf Deutsch Quer-, Höhen-, und Seitenruder, auf Englisch aileron, elevator und rudder. Im Deutschen hat man hier über Wortbildung systematische, sprechende Benennungen, im Englischen Bezeichnungen, die, im Falle von aileron und elevator nur der Spezialist kennt, da die Wortbildungsprozesse in denjenigen Sprachen stattgefunden haben (Französisch, Lateinisch), aus denen die Wörter entlehnt sind. Besonders deutlich wird das auch an dem Ausdruck empennage (dt. Leitwerk), der auf ein altfranzösisches Verb mit der Bedeutung „einen Pfeil fiedern“ zurückgeht. Es geht mir nicht darum, das Deutsche als „besser“ als das Englische vorzuführen. In beiden Sprachen sind treffende Benennungen gefunden worden, aber derselbe Gegenstand wird hierdurch unterschiedlich begriffen.
Dass sich wissenschaftliches Streiten im Deutschen und Englischen zweier Wörter auf unterschiedliche Weise bedient, die jeder im Einklang mit den Wörterbüchern als bedeutungsgleich auffassen darf, mag zunächst überraschen. „Because“ kommt in englischen wissenschaftlichen Aufsätzen nicht nur wesentlich häufiger vor als „weil“ in deutschen, sondern es werden damit teilweise auch völlig verschiedene sprachliche Handlungen vollzogen. Mit „weil“ wird das Wissen versprachlicht, das für die mit dem Hauptsatz vollzogene sprachliche Handlung entscheidungsrelevant geworden ist. In der Wissenschaft wird „weil" gebraucht, um die Argumentation auf diejenigen Entscheidungsprozesse hin durchsichtig zu machen, die zu ihr geführt haben. Das Ziel ist es, Verstehen herzustellen. Demgegenüber geschehen im Englischen mit „because“ oft Rückführungen auf anderen Wissenschaftlern unterstellte Beweggründe („Nevertheless, P adopts the solution, because it eliminates the need for tri-tonal accents“). Das neue Wissen wird - im Rahmen einer antagonistischen Konzeption des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses - in Profilierung am wissenschaftlichen Gegner durchgesetzt. Das Ziel ist es hierbei, den Leser zu überzeugen.
Das sind die Voraussetzungen, unter denen man eine Nutzung des Englischen als sogenannter „Lingua franca der Wissenschaft' diskutieren muss. Die erste Lingua franca war, als rudimentäre Verkehrs- und Handelssprache, ein Idiom, in dem sich allenfalls elementare wirtschaftliche Zwecke verfolgen ließen. In der Wissenschaft sind aber die Zwecke, wie aus den vorangegangenen Bemerkungen hervorgegangen sein dürfte, erheblich komplexer. Das Englische ist - wie alle Sprachen - zwar als Lingua franca möglich. In einer Lingua franca ist aber keine Wissenschaft möglich. Mithin ist für deutsche Wissenschaftler eine Teilnahme am angelsächsischen Wissenschaftsdiskurs fast nur durch Initiation in die anglophone Gemeinschaft der Wissenschaftler erreichbar.
Für deutsche Wissenschaftler kann das Englische nicht mehr sein als ein Idiom, in dem sie - oft mehr schlecht als recht - neue Befunde mitteilen können. In dieser Sprache Neues zu fixieren, es gegen andere Auffassungen zu verteidigen, ist ihnen hingegen nur schwer möglich. Damit liegt die Hoheit, Neues, auch neue Terminologien, in die Wissenschaft einzuführen und durchzusetzen, ganz wesentlich bei anglophonen Wissenschaftlern. Wird der deutschen (und der europäischen) Wissenschaft das Englische durchgehend verordnet, wird sich das angelsächsische Monopol, das bei den „international refereed Jounals“ und den Zitationsindices besteht, auch auf die gesamte Theoriebildung ausdehnen. Ausgerechnet der konkurrenzorientierte Wissenschaftsdiskurs wird sich in Europa dann so abspielen, dass angelsächsische Theorien und Terminologien autoritativen Status besitzen und Wissenschaft hierzulande dann bestenfalls noch in derNachahmung besteht. Dies würde zu autoritätsbasierten Strukturen führen, wie sie für die Scholastik charakteristisch sind, und diejenige Pluralität verhindern, ohne die neuzeitliche Wissenschaft nicht denkbar ist. Damit sind diejenigen kanonischen Verhältnisse wieder hergestellt, denen man einst durch Mehrsprachigkeit entkommen ist: Scholastik statt Neuzeit.
Denkt man dies weiter, so ist man rasch bei einer Wissenschaftsdiktatur amerikanischer Prägung, die ihre Theorien, Termini und Traditionen weltweit durchsetzt und die Voraussetzungen dafür schafft, dass eine externe, das heißt anderen (und eben auch anderssprachigen) Traditionen sich verdankende Kritik nicht mehr möglich ist. Das ist zwar gut für diejenigen, die am Geschäft mit der Wissenschaft verdienen, aber das wissenschaftliche Geschäft, das sich aus der Differenz speist, ist damit beseitigt - und seine anderssprachig verfassten Erkenntnis- und Denkgewinne auch. Dass man sich auf internationalem Parkett zur Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse einer Sprache bedient, in der die kontinentalphilosophische Entwicklung vom späten 18. Jahrhundert an nicht ernsthaft sprachausbauend mitvollzogen wurde (Erkenntnistheorie ist nicht theory of knowledge; Anschauung nicht intuition), mag unter bestimmten Aspekten sinnvoll sein. Dass man aber über die wissenschaftlichen Institutionen und Strategien (Exzellenzstrategie sowie Wissenschaftsförderorganisationen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie sich anglophonisierende Universitäten) anglophone Theorien und Traditionen erzwingt, kann nicht hingenommen werden.
Vor diesem Hintergrund ist es an der Zeit, dass sich Europa darauf besinnt, welchen Wettbewerbsvorteil die Pluralität der Wissenschaftssprachen im globalen Spiel bietet. Hierfür wäre es dringend erforderlich, in größerem Rahmen die Rolle wissenschaftlicher Mehrsprachigkeit bei der wissenschaftlichen Innovation zu untersuchen. Es ist noch kaum etwas darüber bekannt, wie sich die Charakteristika spezifischer Sprachen auf das Wissenschaft-Treiben auswirken. Erste Befunde des Deutsch und Italienisch im Rahmen universitärer Lehre vergleichenden euroWiss-Projekts lassen auf erhebliche Differenzen schließen, die nicht nur die Verbalisierung von Wissen betreffen, sondern auch seinen Status, also unter welchen Bedingungen etwas als wissenschaftliches Wissen gilt. Der europäische Weg kann insgesamt nur darin bestehen, die die längst fälligen konkurrierenden Institutionen der Wissenschaftsförderung, -dokumentation und -beurteilung zu schaffen, die einzelnen ausgebauten Wissenschaftssprachen in der universitären Lehre beizubehalten und ihre Beibehaltung auch in der Forschung dort zu fördern, wo es um die Erkenntnisgewinne und ihre Diskussion (und noch nicht um ihre internationale Kommunikation) geht.
Hinweis: Der Autor ist Professor für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an der TU Chemnitz und hat bei der Tagung „Die Sprache von Forschung und Lehre“ des Arbeitskreises „Deutsch als Wissenschaftssprache e. V.“ (ADAWIS) in Tutzing vorgetragen. Dieser Gastbeitrag von Prof. Dr. Winfried Thielmann erschien am 22. März 2018 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Politik, Seite 6), die der Veröffentlichung auf „Uni aktuell“ zugestimmt hat.
Mario Steinebach
23.03.2018