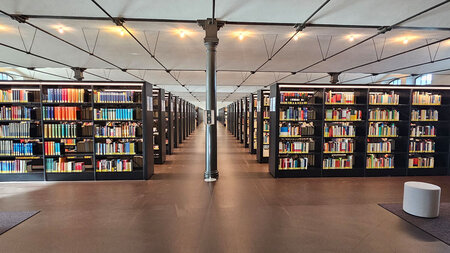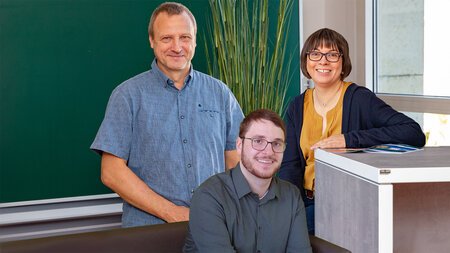Ethik/Philosophie
 |
Gedankenverloren kommt Sophie mit ihrem Buch in den Garten. Als ihr Vater sie fragt, ob sie etwas beschäftige, antwortet sie: „Ich habe gerade das Märchen von Rumpelstilzchen gelesen und verstehe nicht, was sich Rumpelstilzchen dabei gedacht hat. Erst hat es schließlich der Müllerstochter geholfen, dann aber wollte es ihr Kind haben. Es wusste doch aber ganz genau, dass sie ihr Kind sehr liebt. Das passt doch gar nicht zusammen, oder? War Rumpelstilzchen nun gut oder böse?“. Der Vater wird nachdenklich. „Hm“, erwidert er, „das ist ja eine spannende Frage. Das muss einem erst mal einfallen.“ Als die Mutter nach Hause kommt, sitzen die beiden immer noch im Garten. Sie haben offenbar etwas sehr Wichtiges zu besprechen… (in Anlehnung an Balasch, U. (Hrsg.), Bruntsch, K., Thieler, I. & Trautmann, T. (2005). Ethik 3. Ein Schülerbuch für das 3. Schuljahr. Berlin: Cornelsen.).
Von Natur aus fasziniert und beschäftigt Kinder das Leben. Sie staunen über Erscheinungen und hinterfragen sie, wenn diese für sie nicht erklärbar sind. So stellen sie zahlreiche Fragen zur Existenz, zu dem Wesen von Gut und Böse oder zu einem gelungenen Leben. Obwohl sie noch keine Vorstellung vom Philosophiebegriff per se haben, eröffnen ihre Fragestellungen beachtliche philosophische Gesprächsdimensionen. Um Hintergründe zu erschließen, eigene, neue Erkenntnisse zu gewinnen und sich in der Welt zurechtzufinden, passen sich Kinder nicht einfach nur an, sondern stellen die Welt eben in Frage. Indem sich Erwachsene am Fragen und Weiterfragen interessiert beteiligen, sich Nachdenkgesprächen mit Kindern bewusst widmen und sie als gleichberechtigte, nachdenkende Individuen ansehen und schätzen, können sie die kindlich philosophische Annäherung an die Welt in besonderem Maße unterstützen.
Kinder dabei hilfreich zu begleiten, praktisch auf Spurensuche zu gehen und mögliche Antworten auf ihre Fragen zu finden, stellt auch für Lehrkräfte an Grundschulen eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe dar. Dieses Prinzip soll neben anderen Fächern auch im Unterrichtsfach Ethik realisiert werden. Der Ethikunterricht, welcher in Sachsen bereits ab der 1. Klasse gelehrt wird, muss für die Schülerinnen und Schüler, die in einer pluralen Gesellschaft aufwachsen, offen gestaltet sein. Folglich übernehmen Lehrende des Faches Ethik im Unterricht die Aufgabe, v.a. beratend, Werte vermittelnd, Impulse gebend, Grenzen öffnend und sensibilisierend zu wirken.
Um dies umsetzen zu können, ist eine facettenreiche Ausbildung notwendig, die ab dem Wintersemester 2013/2014 an der Technischen Universität Chemnitz mit der Immatrikulation in das Studienfach Ethik/Philosophie (Schwerpunkt Philosophieren mit Kindern) im Studiengang Lehramt an Grundschulen ein Novum darstellt. Das Studium impliziert sowohl fachdidaktische als auch fachwissenschaftliche Inhalte und befähigt die zukünftigen Studierenden nach ihrem Abschluss zur Lehre an Grundschulen im Fach Ethik/Philosophie.
Der überwiegende Anteil dieser Ausbildung ist der Fachwissenschaft gewidmet, welche die beiden Bereiche der Praktischen (Ethik) und Theoretischen Philosophie umfasst. Das Studium beginnt mit einer Lehrveranstaltung zu philosophischen/ethischen Grundlagen, in der die Studierenden allmählich und systematisch an die Wissenschaft der Philosophie herangeführt werden. Die weiteren Lehrveranstaltungen sind so strukturiert, dass sie inhaltlich schrittweise aufeinander aufbauen.
Zum fachwissenschaftlichen Studium zählen folgende Schwerpunkte:
- Konzepte, Fragestellungen und Lösungsansätze exemplarisch ausgewählter historischer und aktueller Strömungen der Praktischen Philosophie sowie zentrale Probleme der Ethik (z.B. Wesen des Menschen, Freiheit, Glück, Verantwortung);
- Grundbegriffe, Fragestellungen und Lösungsansätze der philosophischen Ästhetik sowie historische und aktuelle Konzeptionen einer ästhetischen Bildung;
- Grundbegriffe, Fragestellungen und Lösungsansätze exemplarisch ausgewählter historischer und aktueller Strömungen der Theoretischen Philosophie sowie zentrale Probleme der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie (z.B. Wahrheit, Objektivität);
- Religiöse Systeme (Weltreligionen) und ethisch relevante Kulturpraktiken (vor allem im Hinblick auf die Wertevermittlung).
Im Studium der Fachdidaktik werden die Studierenden stufenweise an das Bildungsprinzip des Philosophierens mit Kindern herangeführt. Sie werden für das Philosophieren einerseits und für Nachdenkgespräche mit Kindern als Unterrichtsprinzip andererseits sensibilisiert. Sie erwerben u.a. elementare Kompetenzen didaktisch-methodischen Handelns und werden befähigt, einen kindorientierten Ethikunterricht zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Die Prüfungsleistungen zu den Lehrveranstaltungen sind überwiegend anwendungsbezogen und praxisorientiert.
Zum fachdidaktischen Studium zählen folgende Schwerpunkte:
- Inhalte, Vermittlungsmethoden, Lehr- und Lernziele und Medien des Ethikunterrichts;
- Philosophiegeschichtliche Wurzeln, zentrale Ansätze/Richtungen und Inhalte sowie Arbeitstechniken/Methoden zum Philosophieren mit Kindern;
- Moderationstechniken, Gesprächsführung und –strategien;
- Sensibilisierung für unterschiedliches Sprachverstehen und unterschiedlichen Sprachgebrauch der Grundschülerinnen und –schüler sowie für verschiedene kulturelle und religiöse Deutungsmuster in Bezug auf ethische und philosophische Themen;
- Initiierung und Anregung philosophischer Gespräche mit Kindern;
- Führen und Leiten von Nachdenkgesprächen mit Kindern;
- Praxisübungen zum eigenen Philosophieren;
- Planung, Gestaltung und Nachbereitung von Unterrichtseinheiten.
Die fachwissenschaftlichen und –didaktischen Inhalte werden mit Blick auf deren Umsetzung in den schulpraktischen Studien erarbeitet.