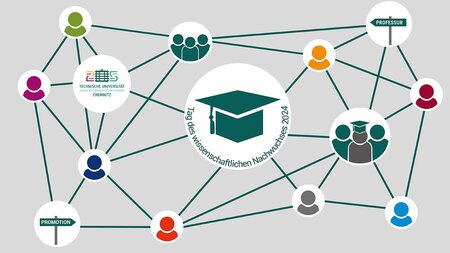Im Land, das keiner (aner)kennt
Politikwissenschaftler PD Dr. Tom Thieme berichtet über Transnistrien, das für die Abspaltung von der Republik Moldawien und seine Eigenständigkeit kämpft
-

Mit Lenin hat man in Transnistrien keine Probleme – wie das gewaltige Lenindenkmal vor dem Parlaments- und Regierungsgebäude in der Hauptstadt Tiraspol beweist. Foto: Tom Thieme
Rubel, die keiner haben will. Pässe, die nirgendwo gültig sind. Ein Regime, von dem die Welt kaum Kenntnis nimmt. Das ist Transnistrien. Es kämpft unbeirrt für die Abspaltung von der Republik Moldawien und seine Eigenständigkeit. Russland leistet Beistand, denn Transnistrien gilt als Überbleibsel der einstigen Supermacht Sowjetunion. Der Chemnitzer Politikwissenschaftler PD Dr. Tom Thieme hat diesen Teil der Erde bereist.
„Good Bye, Lenin!“ hieß der Kinoerfolg des Jahres 2003 – die Geschichte der Ostberliner Familie Kerner während des Epochenbruchs 1989/90. Die überzeugte Sozialistin Christiane – gespielt von Katrin Sass – erleidet vor dem Hintergrund der Demonstrationen gegen das SED-Regime einen Herzinfarkt. Sie fällt ins Koma und erwacht erst im Juni 1990. Deutschland befindet sich auf dem Weg zur Vereinigung und die DDR auf dem in die Geschichtsbücher. Um jede Aufregung zu vermeiden, beschließt ihr Sohn (Daniel Brühl), die DDR weiterleben zu lassen. Der Aufwand ist gewaltig. Dabei hätte der Junior alles einfacher und vor allem bis in die Gegenwart anhaltend haben können: in der von Berlin nur 1600 Kilometer entfernten „Republik Transnistrien“.
Das Land Transnistrien, das keines ist und bis heute kein Staat der Welt anerkennt, wurde am 2. September 1990 gegründet. Dem gingen die Unabhängigkeitserklärung der sowjetischen Teilrepublik Moldawien (Republik Moldau) und der Konflikt um die Abschaffung des Russischen als Amtssprache voraus. Die Führung der überwiegend russisch-sprachigen Bevölkerung auf der Ostseite des Flusses Dnister erklärte das Gebiet daraufhin für unabhängig. Der bewaffnete Konflikt zwischen Moldau und dem von der russischen Armee unterstützten abtrünnigen Gebiet Transnistrien dauerte bis 1992 und endete mit einem Status quo.
Der existiert bis heute: Die schwache Führung in Moldaus Hauptstadt verfügt nicht über die Machtmittel, die Kontrolle über das Territorium zurückzugewinnen. Russland wiederum hat zwar Interesse an einem politischen Störfaktor im Rücken der Ukraine und an der EU-Außengrenze, scheut aber die Annexion einer weiteren Enklave neben Kaliningrad und der Krim. Obwohl sich Moldauer und Transnistrier – abgesehen von einigen Kriegsschicksalen – alles andere als feindselig gegenüberstehen, streben beide Bevölkerungsgruppen keine Wiedervereinigung an.
Die Symbole der einstigen Supermacht sind allgegenwärtig: Rote Sterne an der Grenze, die keine ist. Hammer und Sichel auf der Flagge, die außerhalb niemand hisst, und der transnistrische Rubel, den keiner akzeptiert.
Heute leben etwa 500.000 Menschen in einem 200 Kilometer langen und teilweise nur 20 Kilometer breiten Steifen zwischen Moldau und der Ukraine. Die offizielle Selbstbezeichnung Pridnestrowische Moldauische Republik sagt viel über das Weltbild der Machthaber: Pridnestrowjen bedeutet in etwa „vor dem Dnister“, was geografisch und politisch jedoch nur zutrifft, wenn das östlicher gelegene Moskau das Zentrum der Landkarte markiert. Doch nicht der Nationalstaat Russland ist heute Vorbild für das Modell Transnistrien, sondern noch immer die Sowjetunion. Die Symbole der einstigen Supermacht sind allgegenwärtig: Rote Sterne an der Grenze, die keine ist, zu Moldau. Hammer und Sichel auf der Flagge, die außerhalb niemand hisst, und der transnistrische Rubel, den keiner akzeptiert. Nicht zu übersehen sind die unzähligen Lenindenkmäler, die anderenorts längst abgerissen wurden. Kinder werden wie eh und je am 1. September mit traditionellen Pionieruniformen und großem Tamtam eingeschult. Einen Tag später wird die Unabhängigkeit Transnistriens mit einer überdimensionierten Militärparade gefeiert.
Doch auch soziokulturell lebt das sowjetische Erbe in Transnistrien fort und entwickelte sich sogar weiter. Während die 70 Jahre lang von oben verordnete Völkerfreundschaft mit dem Ende der alten Ordnung vielerorts in ethnische Konflikte umschlug, gibt es hier keine nennenswerten Spannungen zwischen ethnischen Moldauern, Russen und Ukrainern. Vielmehr entwickelt sich gerade eine eigene transnistrische Identität – vor allem unter den Jugendlichen, die meist ohnehin von Vorfahren aller drei Bevölkerungsgruppen abstammen. Zu ihnen gehört Olga, die in einem besseren der wenigen Hotels in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol arbeitet. Mit Stolz berichtet sie über ihre multiethnische Herkunft: Halb Russin und jeweils ein Viertel Moldauerin und Ukrainerin sei sie. Sie spricht alle drei Sprachen fließend, dazu makellos Englisch. Auch persönliche Vorteile habe sie dank ihrer Abstammung. Neben der im Ausland nirgendwo akzeptierten transnistrischen Staatsbürgerschaft verfügt sie zugleich über einen moldauischen und einen russischen Pass. Mit Moldauer Ausweis genießt sie Visafreiheit in die Europäische Union. Mit dem russischen hat sie, wie viele ihrer Landsleute, die Möglichkeit, in Russland offiziell zu arbeiten. Nur ein wenig langweilig sei es in der 150.000 Einwohner zählenden transnistrischen Hauptstadt. Kaum internationale Gäste würden sich hierher verirren, von prominenten Besuchern ganz zu schweigen, beklagt die 24-jährige.
Das könnte sich allerdings in den nächsten Jahren ändern, denn die Zeichen stehen auf Öffnung. Bis vor wenigen Jahren war es westlichen Touristen beinahe unmöglich, Transnistrien zu bereisen. Die autoritäre Führung unter Präsident Igor Smirnov (1992 bis 2011) fürchtete Aufwiegelung und Spionage. Zugleich wollte die moldauische Seite lange jede Aufwertung der abtrünnigen Region vermeiden. Doch aktuell gibt es Zeichen der Entspannung. Mitte November gewann der prorussische Kandidat Igor Dodon die Stichwahl um die Präsidentschaft. Eine Wahl, die international kaum beachtet wurde, weil die ganze Welt gerade nach Amerika blickte. Dodon steht für eine Annäherung beider Landesteile und kritisiert die EU-Sanktionen gegenüber Moskau. Darin weiß er sich mit der transnistrischen Führung einig.
Gästen ist der Aufenthalt ohne persönliche Einladung mittlerweile für 24 Stunden erlaubt. Freilich werden Reisende wohl auch in Zukunft nicht in Scharen in das Überbleibsel des Sowjetimperiums aufbrechen. Denn es gibt weder herausragende Landschaften noch einen Zugang zum Schwarzen Meer. Auch die massive Militär- und Polizeipräsenz sowie die (post-)kommunistische Architektur dürften auf Urlauber zwar exotisch, aber nicht wirklich anziehend wirken.
Doch trotz der allgegenwärtigen Sowjetsymbolik ist die Zeit im südöstlichen Zipfel Europas in den vergangenen 26 Jahren nicht stehengeblieben. Das gilt weniger für den politischen Bereich. Mittlerweile wollen zwei kommunistische Parteien demokratischen Anschein vermitteln, tatsächlich unterscheiden sie sich jedoch nur in Nuancen – nämlich ob Russland „nur“ Schutzmacht und engster Verbündeter bleiben soll oder Transnistrien einen Autonomiestatus innerhalb der Russischen Föderation anstrebt. Dies wird aber nicht einmal von Russland unterstützt. Die gesamte politische Elite des Landes gilt als hochgradig korrupt, Waffenschmuggel und die Veruntreuung von Staatsgeldern seien bis in Regierungsämter verbreitet, konstatieren Beobachter.
Vielmehr ist es ein sozioökonomischer Wandel, der beschleunigt durch Globalisierung und Internetrevolution nun Einzug hält – quasi das chinesische Modell eines KP-geführten Staatskapitalismus. Ließ sich Transnistrien lange Zeit fast ausschließlich mit russischen Zuwendungen finanzieren, versucht die neue Führung seit dem Machtwechsel 2011 stärker auf eigenen Beinen zu stehen. Es gibt einen Staatskonzern namens Sheriff, an dem führende Politiker beteiligt sind, mit einer monopolartigen Stellung. Zu ihm gehören Supermärkte, Tankstellen, die auch außerhalb Transnistriens bekannte Schnapsfabrik Kvint, Kinos und Casinos, Mobilfunk- und Internetanbieter, Immobilien sowie der Fußballklub FC Sheriff Tiraspol. Um weiter wachsen zu können, bedarf es jedoch marktwirtschaftlicher Strukturen, moniert auch die EU im Rahmen ihrer Nachbarschaftspolitik. Nichts behindere diese so stark wie inoffizielle und korrupte Grenzregime und bürokratische Handelshemmnisse.
Wer bei einem Besuch in Transnistrien heute vor allem eine Zeitreise in die 1980er-Jahre befürchtet oder erhofft, wird sich wundern. Das Land wirkt trotz der zahllosen Plattenbauten deutlich freundlicher und aufgeräumter als Moldaus Hauptstadt Chisinãu. Hipster gibt es wie in jeder europäischen Metropole. Das Angebot in den Supermärkten entspricht westlichem Standard. Alte Ladas machen – anders als in Moldau – nur noch einen Bruchteil der Autos im Straßenverkehr aus. Wer sich aus Richtung Chisinãu der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol nähert, kommt an einer modernen Fußballarena vorbei, die dem neuen Chemnitzer Fußballstadion zum Verwechseln ähnelt. Das Land und vor allem die Jugend befinden sich im Aufbruch.
Das sieht auch Nikita so, Philologiestudent an der Transnistrischen Staatlichen Universität: Endlich erwache das Land aus dem Dornröschenschlaf. Portugiesen seien da gewesen, eine studentische Delegation aus Tschechien habe sich angekündigt, freut er sich. Doch trotz der Hoffnung auf Öffnung mag auch der 19-Jährige am Status Transnistriens und an den besonderen Beziehungen zu Russland nicht rütteln. Derzeit würden Geschichte und Gegenwart aufeinander prallen. Die Relikte der alten Zeit seien zwar noch da, aber nicht mehr Ausdruck einer verwurzelten kommunistischen Ideologie, vielmehr „Folklore der älteren Generation“, meint Nikita. Ob sich Transnistrien in Zukunft ost- oder westwärts öffnet, ist für ihn und viele seiner Landsleute völlig offen.
(Der Autor lehrt Politikwissenschaft an der Technischen Universität Chemnitz. Sein Beitrag erschien auch am 28.12.2016 in der „Freien Presse".)
Mario Steinebach
28.12.2016